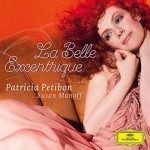Es ist ein ganzes Weilchen her, dass Patricia Petibon an der Wiener Staatsoper zu hören war. 2007 sang sie hier die Sophie in Richard Strauss´ Rosenkavalier, nun kehrt die grazile Französin mit dem feuerroten Haar als Manon zurück – ein Debüt, denn es ist ihre erster Massenet auf einer Opernbühne, höchste Zeit also, findet sie, denn ewig könne man die Manon, „dieses junge, wilde Ding“, ja nicht singen.
Mit seiner „Geschichte des Chevalier Des Grieux und der Manon Lescaut“ skandalisierte Abbé Prevost in den dreißiger Jahren des 18. Jahrhunderts die literarische Welt derart, dass der Roman verboten und verbrannt wurde. Kein Wunder also, dass der Stoff Leser und Komponisten von Auber bis Henze geradezu magische anzog. Als Jules Massenet 1882 die Geschichte vertonte, war er bereits ein reicher Mann, der vom Publikum geliebt und verehrt wurde. Am 19. Jänner 1884 wurde die Liebesgeschichte zwischen der schönen, wegen ihres leichtsinnigen Lebenswandels fürs Kloster bestimmten Manon Lescaut und dem jungen Edelmann Des Grieux in Paris uraufgeführt. Nach der Wiener Erstaufführung am 19. November 1890, schrieb der gefürchtete Kritiker Eduard Hanslick, die Oper sie „die beste und effektvollste seit Bizets Carmen“. Anfang des 20. Jahrhunderts hatte man Massenets Meisterwerk in Paris bereits 500 Mal gespielt, bis heute erlebte Manon ebenda weit über 2000 Aufführungen.
Spätestens seit ihrer famosen Interpretation von Alban Bergs begehrenswerten, einsamen Sexgöttin Lulu, kann man sich Patricia Petibon wunderbar als blutjunges, verführerisches Mädchen vorstellen; ein Luxusgeschöpf, das frei sein will und von einer Welt träumt, der es nie angehören wird. „Manon, Lulu die Kameliendame oder Violetta, das sind alles Frauen, die eine unglaubliche Anziehungskraft besitzen. Bei Manon fasziniert mich vor allem, wie sie sich entwickelt, von der scheinbar unschuldigen Kurtisane hin zur tragischen Figur gegen Ende der Oper“.
Egal ob romantisch, modern oder barock, als Blanche in den Karmelitinnen, als rasende Königin der Nacht oder als verzweifelte Liebende Alcina – wenn Patricia Petibon auf der Bühne steht, dann tut sie dies mit Haut und Haaren. Sie verwandelt sich, brüllt wie ein Löwe, spielt mit der Leidenschaft, haucht einen berührenden Liebesgesang, weint, tanzt und lacht; erotisch, zärtlich, blutvoll. Wenn sie singt, dann geht sie bis an die Abgründe der menschlichen Seele, zwischen himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt. Patricia Petibon spielt keine Rollen, sie verkörpert sie. Sie gibt ihnen ein Gesicht und haucht ihnen Leben ein. „Der Notentext ist wie eine unbekannte Straße. Die Musik entsteht erst durch die vielen Eindrücke, die man nach und nach entdeckt“.
Auf der Bühne, sagt Patricia Petibon, sei sie alles, nur nicht sie selbst. „Eine Rolle zu verinnerlichen bedeutet immer auch das Fremde zum Eigenen zu machen, in dem man den gesamten seelischen Mikrokosmos des Charakters erkundet, mit all seinen Höhen und Tiefen. Das lässt sich nicht einfach abschalten, wenn der Vorhang fällt. Man entwickelt Gefühle, die noch lange nachschwingen. Letzten Winter habe ich Poulencs Karmelitinnen in Paris gemacht. Das war unglaublich hart für mich. Die Gedanken um die Angst und um den Tod haben mich bis in den Schlaf verfolgt. Manchmal bin ich mitten in der Nacht aufgewacht, weil ich keine Luft mehr bekommen habe. Die Oper ist etwas sehr emotionales, weil es um Themen geht, die uns Menschen beschäftigen. Manche Charaktere nehmen einen mehr mit als andere. Bei Lulu zum Beispiel habe ich nach der Vorstellung zu Hause Dr. House geschaut und alles war gut“.
Derzeit hat die Manon Patricia Petibon fest im Griff. Immer wieder liest sie Passagen aus dem Roman und studiert die Partitur, stets auf der Suche nach den Geheimnissen in Massenets feiner und elegant ausgeformter Lyrik. „Alles ist sehr delikat, sehr durchdacht, sehr präzise, bis ins kleinste Detail. Jeder Ton, jede Note hat seine Berechtigung. Massenet überrascht uns immer wieder durch die Schönheit seiner Musik, aber auch durch die Tragik und die Leidenschaft.“
Patricia Petibon liebt das Abenteuer. Regisseure müssten gleichzeitig auch Visionäre sein, sagt sie. „Ich will neue Facetten kennenlernen und überrascht werden. Manchmal bedeutet das auch, dass ich mich zurücknehmen und gleichzeitig öffnen muss. Das Singen hat immer etwas Kantsches. Es ist eine universelle Öffnung, ohne Rücksicht auf Verluste“. Ihre musikalischen Reisen führen Patricia Petibon immer wieder in neue, bisher unerforschte Gebiete. Demnächst erscheint ihr neues Album „La Belle Excentrique“, in dem sie sich dazu aufmacht, die Welt von Fauré bis Ferré, vom Dichter Théophile de Viau bis Manuel Rosenthal zu erkunden. Hier ist der französische Geist allgegenwärtig, mit seinem Charme, seiner Melancholie und seinem derben Spott. Manche Titel verweisen augenzwinkernd auf berühmte Tänzerinnen des Moulin Rouge: auf La Goulue und ihren Partner Valentin le Désossé, auf Gavrochinette, Rayon d’Or oder auch Nini Pattes-en‑l’air („Beine in der Luft“), in deren Tanzschule angeblich nicht nur French Cancan auf dem Lehrplan stand. Zwischendurch tauchen immer wieder Francis Poulenc und Erik Satie auf, den Patricia Petibon als Kind, damals noch am Klavier, kennen- und lieben lernte. „Ich habe mir aus dieser Zeit etwas sehr dadaistisches behalten“, sagt sie. „Die Musik auf der CD spiegelt alles wider: das Komische und das Tragische, das Fantastische und das Geheimnisvolle. Ich gehe gerne von einem Extrem zum anderen. Nur so kann spüren wie intensiv das Leben ist – und der Tod“.